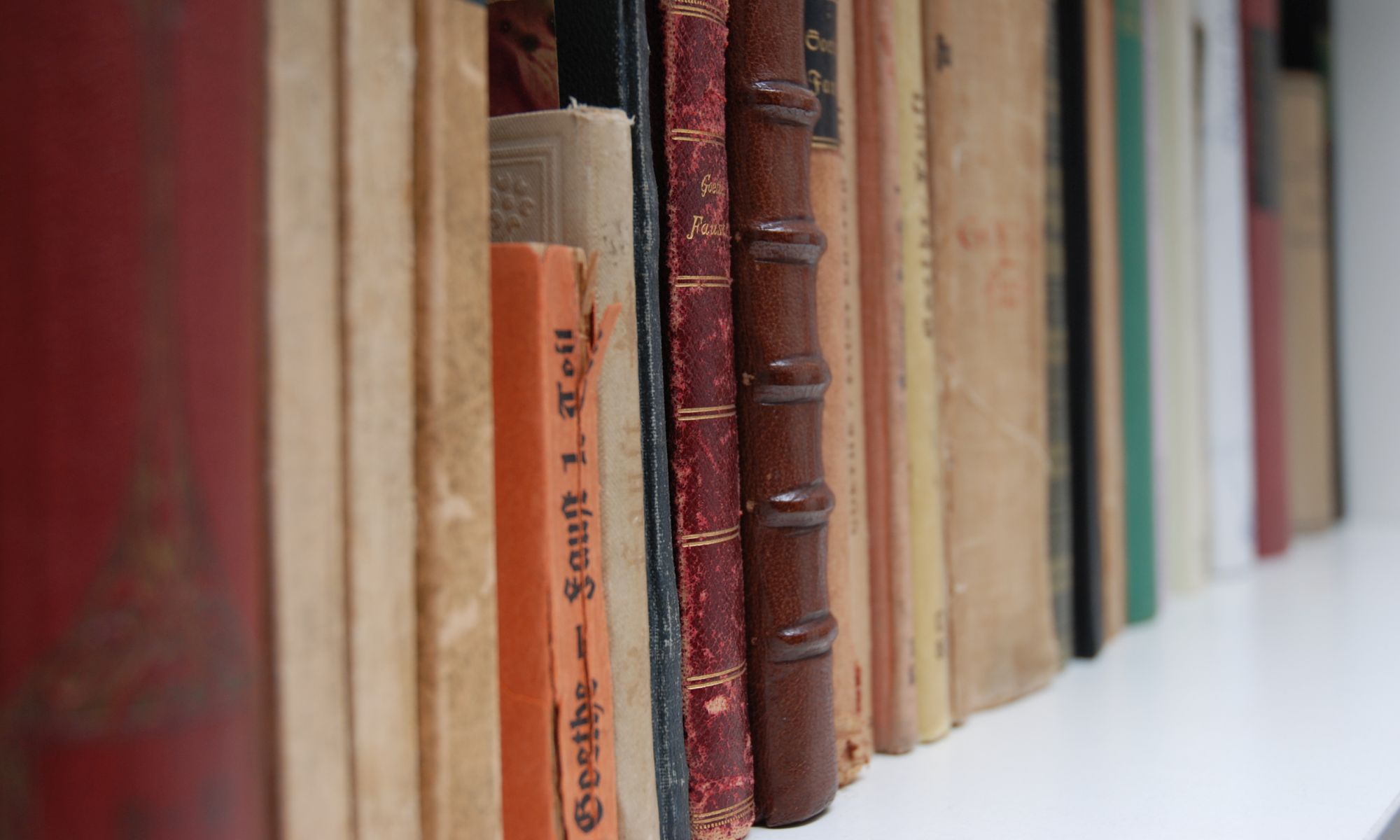In der Zeit des ersten Corona-Lockdowns überschlugen sich die Feuilletons förmlich damit, welche Lektüre nun in dieser Zeit die passende sei. „Die Pest“ von Albert Camus vielleicht? Oder „Die Arbeit der Nacht“ von Thomas Glavinic? Oder Marlen Haushofers „Die Wand“ und „Die Arena“ von Stephen King? SZ.de fragte sogleich: „Die Pest, Momo oder doch die Bibel?“ und sortierte die Empfehlungen in einem Listicle nach Lesetypen. Nur das (ohnehin stets lesenswerte) Online-Magazin „54books“ ließ Till Raether völlig zurecht die grandiose US-amerikanische Autorin Shirley Jackson empfehlen („Immer im Lockdown – Warum Shirley Jackson die Autorin der Stunde ist“).
In der Zeit des ersten Corona-Lockdowns überschlugen sich die Feuilletons förmlich damit, welche Lektüre nun in dieser Zeit die passende sei. „Die Pest“ von Albert Camus vielleicht? Oder „Die Arbeit der Nacht“ von Thomas Glavinic? Oder Marlen Haushofers „Die Wand“ und „Die Arena“ von Stephen King? SZ.de fragte sogleich: „Die Pest, Momo oder doch die Bibel?“ und sortierte die Empfehlungen in einem Listicle nach Lesetypen. Nur das (ohnehin stets lesenswerte) Online-Magazin „54books“ ließ Till Raether völlig zurecht die grandiose US-amerikanische Autorin Shirley Jackson empfehlen („Immer im Lockdown – Warum Shirley Jackson die Autorin der Stunde ist“).
Die 1965 verstorbene Shirley Jackson ist eigentlich keine in völliger Vergessenheit dümpelnde Schriftstellerin. Zuletzt lief sehr erfolgreich die Serien-Adaption von Jacksons „Spuk in Hill House („The Haunting of Hill House“) bei Netflix, und im vergangenen Jahr kam, allerdings wohl nicht ganz so erfolgreich, die Verfilmung von Jacksons letztem Roman „Wir haben schon immer im Schloss gelebt“ in die Kinos. Das Buch, auf dem der Film basiert, ist ein literarisches Juwel, an dem man nicht so achtlos vorbeiziehen sollte, denn es begeistert sprachlich, feministisch, gespenstisch und menschlich.
Der Roman „Wir haben schon immer im Schloss gelebt“ erzählt von den Überresten der einst altehrwürdigen Familie Blackwood: Von der 18-jährigen, eigensinnigen und immer noch etwas kindlich-naiven Mary Katherine – von allen nur Merricat genannt -, ihrer älteren Schwester Constance, und ihrem gebrechlichen Onkel Julian. Alle übrigen Familienmitglieder, mit denen die drei einst in dem herrschaftlichen Anwesen zusammenwohnten, sind durch eine eigentümliche Arsenvergiftung dahingerafft worden. Denn eines Tages, man weiß nicht wie, war Arsen im Zuckerdöschen, mit dem die Familie bei Tisch wie immer ihr Dessert versüßte. Merricat war noch vor dem Abendmahl auf ihr Zimmer geschickt worden, Constance nahm keinen Zucker, Onkel Julian nur wenig. So wenig, dass er überlebte. Zwar schwer angeschlagen, aber er lebt. Der Rest: tot.
Grausame Spöttereien auf den Lippen
Dass solch ein plötzliches Ableben fast einer ganzen Familie im nahen Dorf nicht unkommentiert bleibt, ist kaum verwunderlich. Die Volksseele hat die vermeintliche Übeltäterin schnell gefunden: Es kann ja nur Constance Blackwood sein. Kann ja nur! Also schießt man sich auf sie ein. Der Roman beginnt zu der Zeit, in der Constance schon längst nicht mehr das Anwesen verlässt. Nur Merricat geht dann und wann hinunter ins Dorf, um wenige Lebensmittel zu kaufen und aus der Bibliothek neue Bücher auszuleihen. Der Weg hin und zurück ist ein ewiger Spießrutenlauf. Männer und Frauen machen aus ihrem Urteil keinen Hehl, und die Kinder haben grausame Spöttereien auf den Lippen:
Merricat, fragt Connie, willst du einen Tee?
Oh nein, sagt Merricat, darin ist Gift, o weh!
Merricat, fragt Connie, willst du nicht schlafen nun?
Drei Meter tief im Grabe ruhn!
Der Alltag der Familie Blackwood bestimmt sich in ihrer Oase der Zurückgezogenheit ganz nach Routinen. Die festen Strukturen des Tages und der Woche sind für Merricat wahre Kraftgeber und werden fast magisch aufgeladen. Das sind die Tage, an denen sie das Haus putzt und in dem Zustand hält, wie es einst gewesen ist. Ein Psychiater würde darin vermutlich eine Zwangsstörung sehen. Die Tage, an denen sie ins Dorf muss, sind die kraftraubenden, die schlimmen Tage.
Autoritär, aggressiv und einnehmend
Wie sehr die schlimmen Tage in den empfindlichen Alltag einbrechen können, erfährt Merricat, als plötzlich der schneidige Cousin Charles seine Aufwartung macht. Er ist gekommen, um zu bleiben. Autoritär, aggressiv und einnehmend spielt er sich als berechtigter Patriarch auf.
Damit ist die Bühne für den unvermeidlichen Konflikt bereitet, und es bleibt nicht bloß die Frage: wer überlebt? Sondern auch: wem kann der Leser trauen? Sollten wir jedes Wort einer Erzählerin für bare Münze nehmen, die sich in ihrer Freizeit mit Pilztoxikologie beschäftigt und sich hervorragend auskennt? Und die jegliche Grundstücksgrenzen mit Fetischen, Totems und Talismanen markiert, um die restliche Familie zu schützen? Nun …
„Wir haben schon immer im Schloss gelebt“ ist ein Roman des leisen Horrors, der sich in Zwischentönen auslebt, und an der Oberfläche leicht erzählt scheint. Es ist eine bezaubernde und zugleich beängstigende Geschichte, denn Tod und Unheil reisen ständig mit, und dennoch ist so viel Leben in diesem Roman. Leider sollte es Shirley Jacksons letzter sein.
Shirley Jackson: Wir haben schon immer im Schloss gelebt, Festa Verlag, Leipzig, 2019, 252 Seiten, gebunden, mit Lesebändchen, 19,99 Euro, ISBN 978-3865527097, Leseprobe