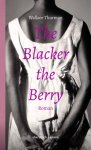Das Feuerwerk ist abgesagt, und wer es in diesem Jahr zu Silvester vermisst, hat einen guten Grund, Sophia Fritz‘ Debütroman „Steine schmeißen“ zu lesen. Denn in diesem in der Jetztzeit von Wien spielenden Roman begleiten wir Anna und ihre Freundinnen und Freunde vom alten Jahr ins neue. Was eine entspannte Silvesternacht werden könnte, gerät zu einem Tanz auf brüchigem Boden – und zu einem Ergebnis, als habe jemand aus Versehen ein Streichholz in die Kiste mit dem Feuerwerk fallen lassen.
Es gibt nicht nur einen guten Grund, dieses Buch zu lesen, es gibt viele: Die Sprache, der Drive, die Figuren, der Witz. Und nicht zuletzt ist es ein umwerfendes, packendes, eloquentes Stück Literatur, bei der wir uns fragen dürfen: Warum, zum Teufel, hat Sophia Fritz erst jetzt angefangen, Romane zu schreiben? Was haben wir in den vergangenen Jahren verpasst!
Sophia Fritz – wer ist das eigentlich? Die Debütantin wurde 1979 in Tübingen geboren, sie studierte an der Hochschule für Fernsehen und Film in München Drehbuch und erarbeitet Serienformate für verschiedene Produktionsfirmen. Sie hat bereits literarischen Kurztexte geschrieben und dafür zahlreiche Literaturpreise und Stipendien bekommen. Außerdem schreibt sie für die Wochenzeitung Die Zeit.
„Ein Freilichtmuseum von Gefühlen“
Und nun also „Steine schmeißen“, über das Sophia Fritz in einem Interview für das Branchenmagazin Buchreport selber sagt: „Ein gordischer Knoten an Beziehung und ein Freilichtmuseum von Gefühlen. Lauter Herzen, die so schwer sind vom Schwimmbad, und Tauwettergesichter, die nicht so genau wissen, wohin jetzt. Und dann auch mein bester Versuch, ehrlich zu bleiben.“
Ehrlich bleiben. Treibt es auch die jungen Erwachsenen an, über die Fritz in ihrem Roman schreibt? Diese Generation Z, die „Z-ler“, die versuchen, cringe Situationen zu vermeiden, tapern in „Steine schmeißen“ so unausweichlich in ihre Zukunft, an langen Fäden gelenkt von einer Autorin, die nicht nur Sprachbilder beherrscht, sondern auch den nötigen Abstand zu ihren Figuren einhält, um ihnen mit direkter Ehrlichkeit die Folgen ihres Handelns vor den Latz zu knallen.
Weil es die Nacht der Nächte ist
Anna und ihre Clique versammeln sich bei Marie, um ganz gemütlich, mit gestreamtem Kachelofen, ins neue Jahr zu feiern. Man fläzt sich in den Ledersesseln, und in den Hosentaschen nehmen die mitgebrachten Drogen die Körperwärme an. Koks und vielleicht eine kleine Menge Ecstasy. Weil es die Nacht der Nächte ist. Und weil diese jungen Menschen intensive Erfahrungen suchen, denn Anna sagt an einer Stelle: “ Nicht mal von Worten lassen wir uns berühren, damit etwas Spuren hinterlässt, muss es uns am Kiefer packen, in den ersten drei Sekunden explodieren oder sehr persönliche Fragen stellen“. Da hat man keine Fragen mehr.
Sie alle bringen an diesem Abend ihr Päckchen mit. Die Halbwaise Anna ist von ihrem Freund, ihrer großen Jugendliebe, verlassen worden, aber niemand außer ihrer Mutter weiß davon. Ihren Freunden erzählt sie, Alex habe Magen-Darm. Jara und Lukas sind in einer On-off-Beziehung, Marie dagegen „hat nie jemand Festes bei sich, nur manchmal ihren Bruder, von dem sie sich beschützen lässt“: Samir, mit dem sich Anna seit zwei Jahren trifft, wenn sie harten Sex braucht. Weiß aber natürlich niemand. Marie hat sich die Wangen unterspritzen lassen, um ihren Vater aus dem Gesicht zu tilgen; weiß Anna.
Fede ist auch da, das ist Annas bester Freund. Der will sich in den nächsten vier Stunden noch verlieben und dabei am liebsten betrunken sein. Anna erinnert sich an dessen Vater und wie der ansonsten so schweigsame Mann einmal sagte: „Es tut mir leid, dass das nichts geworden ist mit der Idylle.“ Manchmal brechen sich Weissagungen auf ungewöhnliche Art und Weise Bahn. Eine weitere könnte sein: Eigentlich sind Tantramasseur*innen die wahren Retter*innen in der Not.
Schöne Idee, leicht esoterisch angehaucht
Es ist Lukas, der den Stein ins Fliegen bringt. Er hat die Idee, dass sie alle mit Filzstiften jene Dinge auf Steine schreiben, die sie loswerden wollen. Vor Mitternacht sollen die Steine dann in die Donau geworfen werden, um sich damit sinnbildlich von den jeweiligen Belastungen zu befreien. Schöne Idee, leicht esoterisch angehaucht, aber das Ding geht – um in der Böllersprache zu bleiben – komplett nach hinten los und zerfetzt jede Form von Geheimnis und Stillschweigen.
Sophia Fritz schreibt mit einem Blick für Dramaturgie prägnante, scharf umrissene Sätze. Klar, möchte man sagen, sie hat das Drehbuchschreiben ja studiert. Aber eine studierte Drehbuchschreiberin ist ja nicht automatisch eine hervorragende Romancière.
„Steine schmeißen“ kitzelt beim Lesen den Wunsch, hier und dort ein paar Sätze zu notieren, um sie nicht zu vergessen. Kleinode wie „Der Himmel hat Lampenfieber und winkt die Wolken weiter“, „rutschige Träume“, „Baumwollbrüste“, „ein Herz wie ein Sitzsack“, „laufen, als würde ich auf Schnitzel und Schlagringe stehen“, „das Gesicht in die Handflächen einbuddeln“, „mit den Augen vertippen“ und „das Geländer ist es gewöhnt, festgehalten zu werden“. In ähnlich starker Sprache schreibt noch Simone Buchholz ihre Krimis.
Was Sophia Fritz leider nicht beherrscht, aber auch hier ist sie in bester Gesellschaft, ist das Wortfeld „sagen/sprechen“. So lässt sie jemanden ein „Ja“ lächeln, wenig später nickt jemand ein „mega“, dann wieder räuspert sich Lukas ein „ich glaube“. Das soll mal jemand beim Film versuchen: „Ich glaube“ sagen und sich gleichzeitig räuspern. Das „Mega“-Nicken wird später noch ergänzt durch ein „‚Touché‘, nickte er.“ Nun. Es muss ja auch nicht alles schön sein in der deutschen Literatur.
Sophia Fritz hat einen großen Wurf getan, und es werden weitere folgen. Bereits für das Frühjahr ist im Kanon-Verlag ein zweites Buch von ihr angekündigt, das sie zusammen mit Martin Bechler, dem Mastermind der Kölner Indie-Band „Fortuna Ehrenfeld“, geschrieben hat. „Kork“ heißt es und soll vom richtigen Wein im falschen Leben erzählen. Der hätte Anna und Konsorten aber auch nicht mehr geholfen. Ehrlich bleiben, das schon eher.
Sophia Fritz: Steine schmeißen, Kanon-Verlag, Berlin, 2021, 229 Seiten, gebunden, 22 Euro, ISBN 978-3985680078
Seitengang dankt dem Kanon-Verlag für die Bereitstellung eines Rezensionsexemplars.