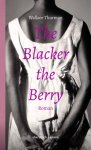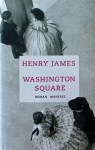Hand aufs Herz: Kennen Sie den US-Amerikaner Andrew Haswell Green? Die meisten Menschen dürften das verneinen, obgleich sie im selben Atemzug eine Frage nach der Bekanntheit des Central Parks von New York City bejahen würden. Ohne Andrew Haswell Green gäbe es heutzutage jedoch keinen Central Park, keine New York Public Library, kein Metropolitan Museum of Art. Zum Anfang des 20. Jahrhunderts erhielt Green gar den Beinamen „Vater von Greater New York“, weil er entscheidend daran mitgewirkt hat, dass sich Manhattan und Brooklyn, Queens und Staten Island zu einer einzigen Stadt vereinen.
Und heutzutage? Ist der Mann nahezu vergessen. Dank eines einfühlsamen Romans des britischen Autors Jonathan Lee dürfte sich das in Teilen ändern oder bereits geändert haben. Im vergangenen Frühjahr erschien im Diogenes-Verlag sein Buch „Der große Fehler“. Es erzählt die bewegende Lebensgeschichte von Andrew Haswell Green – aber auch die mysteriösen Hintergründe seines abrupten und tragischen Ablebens. Denn Green wurde plötzlich und unerwartet auf der Treppe vor seinem Haus mit fünf Pistolenkugeln niedergestreckt. Wer sollte diesem Mann von 83 Jahren nach dem Leben trachten?
Der bei London aufgewachsene Jonathan Lee ist bereits 2012 nach New York City gezogen und spaziert gern durch den Central Park. Eines Tages entdeckt er eine marmorne Bank, die schon etwas verwittert ist. Tauben haben ihre Geschäfte darauf erledigt, und einmal pro Woche kommt jemand, um den Dreck zu entfernen. In die Rückenlehne ist eine Inschrift eingraviert: „Zu Ehren von Andrew Haswell Green / Dem Schöpfergeist des frühen Central Park / Vater von Greater New York“. Der Name sagt Jonathan Lee, dem Autor von drei Romanen, dem New Yorker Verlagsmitarbeiter und Drehbuchschreiber, überhaupt nichts. Null. Er beginnt zu recherchieren und weiß bald: Das wird mein nächster Roman.
Erzählerisch äußerst gelungen
Der ist vor allem erzählerisch äußerst gelungen und sprachlich glänzend geschrieben. Es ist weniger ein Kriminalroman als ein biographischer Zugang in das New York zur Jahrhundertwende. Natürlich behandelt Lee auch die Ermittlungen des wunderbaren Inspectors McClusky, der in der Not steht, sich beweisen zu müssen, nachdem er zuvor durch ein Ungeschick seinen Ruf in der Polizeitruppe ruiniert hat. Dieser Erzählstrang nimmt jedoch nicht so viel Zeit ein, wie der Klappentext des Buches das vermuten ließe.
Auf einer zweiten Zeitebene erzählt Lee detailreich vom Aufwachsen, Leben und Handeln des einst berühmten Mannes. Greens Eltern haben elf Kinder, er selbst ist das siebte in der Reihe. Ein zurückhaltender, schmächtiger Junge, der Ordnung liebt und gerne zeichnet, dem aber nicht erlaubt wird, die Schule zu besuchen. Denn seine Arbeitskraft ist auf dem Bauernhof der Familie in Massachusetts wesentlich mehr von Nöten. Als Green 12 Jahre alt ist, stirbt seine geliebte Mutter. Ein Schock für ihn. Als man ihn dabei erwischt, wie er seinen besten (und einzigen) Jugendfreund küssen will, schickt ihn der Vater in die Lehre bei einem befreundeten Gemischtwarenhändler in New York.
Dort blüht Andrew Haswell Green auf, und er soll es noch mehr tun, als eines Tages der junge Anwalt Samuel Tilden in den Laden schneit. Der nimmt sich seiner an, macht ihn zu seinem Assistenten, zeigt ihm die Welt der Bücher („Ich glaube, dass man ohne eine Vorliebe für das Lesen niemals ein eleganter Mann werden kann“) und wird später stadtbekannte Projekte mit ihm umsetzen. Allen voran den Central Park, einen öffentlichen Park, der für alle Menschen frei zugänglich sein soll – ungewöhnlich für die Zeit, war man doch sonst bestrebt, Eintritt zu verlangen, um die Landstreicher und Kriminellen aus den Parks zu halten. Außerdem sollten Manhattan und Brooklyn zusammengeführt werden. Eine Idee, die manchen Zeitgenossen sehr zuwider war, die Green aber mit großer Verve verfolgte.
Bangen um ihr Ansehen und Wirken
Es ist mehr als eine innige Freundschaft, die die beiden Männer verbindet. Doch sie sind zu keiner Zeit bereit, ihre Liebe zueinander öffentlich zu machen, weil es sie bangt, dass nicht bloß ihr Ansehen, sondern vor allem ihr Wirken und ihre Vorhaben für die Gesellschaft dadurch Schaden nehmen können. Jonathan Lee beschreibt diesen inneren Kampf der unmöglichen Liebe, des Wollens, aber nicht Könnens, behutsam und mit viel Wissen um die Nuancen dieser Entscheidung.
Jonathan Lee hat seinen Roman in 33 Kapitel unterteilt, die als Überschrift jeweils die Namen der Parkeingänge zum Central Park tragen und schon erste Hinweise auf den Kapitelinhalt erlauben. Lee hat damit auch in der äußeren Form einen Rückgriff auf Greens Werk geschaffen, alle Wege durch die Tore seines Romans führen in den Central Park. Ist das der „große Fehler“, der dem Buch seinen Titel gibt, der Central Park? Jemand sagte mal, er halte den Park mitten in der Stadt für eine „schwache, sentimentale Idee“. Oder war es ein Fehler, dass Green am Morgen des 13. Novembers 1903, der ein Freitag war, sich keinen Talisman gegen das Unheil und das Böse an den Körper gelegt hat? Oder hat der Mann, der ihn erschoss, möglicherweise den falschen umgelegt?
Selbstverständlich gibt es eine Lösung, wie es auch ein Motiv für den Mord gibt. Beides klärt Jonathan Lee in seinem Roman auf, und doch sind beide Auflösungen zweitrangig, denn in erster Linie gelingt es Jonathan Lee auf literarisch hohem Niveau einen Mann wieder ins Licht zu holen, der zu lange Zeit vergessen war. Jede Frau und jeder Mann sollte dieses Buch gelesen haben, bevor ein jeder auch nur einen Fuß durch eines der Tore im Central Park gesetzt hat. Alles andere wäre ein Fehler.
Jonathan Lee: Der große Fehler, Diogenes-Verlag, Zürich, 2022, 367 Seiten, gebunden, 25 Euro, ISBN 978-3257071917, Leseprobe, Hörprobe