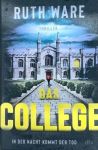Passend zum internationalen Batman-Tag am 16. September tauchte in diesem Jahr die ausgesprochen aufregende erste Ausgabe von Rafael Grampás Comic „Batman: Der Gargoyle von Gotham“ aus den Schatten auf. Der mit dem renommierten Eisner-Award ausgezeichnete brasilianische Comic-Künstler bebilderte zuvor bereits die Episode „Batman: Das goldene Kind“ für den Comic-Star Frank Miller („Sin City“). Jetzt hat Grampá eine neue, eigenständige Geschichte über Batmans Anfangszeit geschrieben und gezeichnet. Sie könnte ein neuer Klassiker der Batman-Comics werden. Wer bisher keinen Zugang zu dem dunklen Ritter hatte – hier wäre der richtige Einstieg ins Batmobil.
Grampás Gotham ist wesentlich düsterer und hoffnungsloser als in anderen Darstellungen. Auf den ersten Seiten sehen wir, wie die Schere zwischen Arm und Reich auseinanderklafft. In den Straßen häufen sich Müllsäcke zwischen den imposanten Bauten, Obdachlose drängen sich in den Hauseingängen, während Passanten nur Augen für ihre Smartphones haben. Gewalt, Korruption und Ausbeutung haben Einzug gehalten, und es gibt nur einen, der die Entwicklung noch aufzuhalten vermag: Batman. Der hatte sich bekanntlich am Grab seiner Eltern geschworen, das Böse zu bekämpfen.
Töte Bruce Wayne – sei Batman
Aber so recht will es nicht gelingen, denn im Hauptjob ist er ja auch noch Bruce Wayne, der Milliardär. Nachdem Batman bei einer Begegnung mit einem unheimlichen Bösewicht beinahe durch eine Explosion in einem TNT-Labor gestorben wäre, offenbart er seinem engsten Vertrauten, dem Butler Alfred Pennyworth, dass er den öffentlichen Tod von Bruce Wayne plant. Ausradieren müsse er sich, um sich ganz seiner Mission zu widmen. „Die Lage wird immer schlimmer, und Gotham muss permanent geschützt werden“, sagt er selbstbewusst.
Unterdessen treibt ein beunruhigender Serienmörder in Gotham sein Unwesen, und die Polizei ist noch völlig ahnungslos. Sie registriert nur immer mehr Todesfälle, bei denen die Opfer seltsam übereinstimmende Stichverletzungen haben und immer nackt zurückgelassen werden. Dann findet der Polizist Jim Gordon eine Verbindung zu Bruce Wayne, und alles dreht sich in eine völlig unerwartete Richtung.
Charakterzeichnung ist brillant
Mit „Der Gargoyle von Gotham“ erleben wir die Stadt nicht nur ungewöhnlich dunkel und abgehalftert, sondern auch Batman zeigt sich in neuen charakterlichen Facetten. Grampás Schachzug, Bruce Wayne abzunabeln und sich vollständig auf Batman zu konzentrieren, ist außerordentlich gelungen. Seine Charakterzeichnung ist brillant. Der junge Batman ist bei Grampá grimmig und zuweilen auch brutal, aber immer auf dem Höhepunkt seiner Fähigkeiten, auch als er seine eigene Identität in Frage stellt.
Als kontrastierender Gegenpol glänzt der neue furchterregende Schurke Crytoon. Er ist ein übler Mörder mit glatter, schwarzer Haut, einem schwarzen Anzug und psychotisch laufenden Tränen. Seine Tränen, erklärt er an einer Stelle, sind die Vorboten der Tränen seiner Opfer. Grampá zeigt ihn als mordendes Wesen, dem seine Taten bewusst sind und die er zuvor bedauert, sie jedoch nicht aufhalten kann. Wie Batman hadert auch Crytoon mit seiner Identität.
In einem Interview, das thepopverse.com mit Rafael Grampá geführt hat, erzählt der Comic-Künstler, dass ihn eine Erinnerung an die eigene Kindheit zu Crytoon inspiriert habe. Grampás Großmutter liebte die klassische italienische Theaterkunst der Commedia dell’arte und bewahrte deshalb eine ganz in weiß gekleidete Porzellanfigur des ikonisch weinenden Clowns Pierrot auf.
Grampá: „Ich hatte Angst vor diesem Bild.“
„Als ich ein Kind war, hatte ich große Angst davor“, erzählt Grampá in dem Interview: „Diese Figur, dieses weiße Gesicht, das schwarze Tränen weint; wenn sie das Licht ausschaltete, sah ich das vor mir und hatte Angst vor diesem Bild.“ Aus diesen Kindheitserinnerungen entwickelte Grampá seine eigene Version des Pierrot. Um ihn dann auch noch von den anderen Clown-Schurken im Batman-Universum abzugrenzen, brachte ihn seine Frau auf die Idee, den ursprünglichen Pierrot in ein Foto-Negativ umzukehren. Crytoon ist geboren!
Und schließlich ist da noch der Polizist Jim Gordon, den Grampá als religiösen Mann darstellt. In seiner trostlosen Wohnung hängt ein Jesusbild an der Wand, in seinem Büro im Revier ein ans Holzkreuz genagelter Jesus. Auf einem Schubladenelement steht eine Madonnafigur. Nur auf dem Telefontischchen zu Hause sehen wir ein Foto von Gordons Frau. Daneben liegt die Dienstwaffe. Die Pflicht ruft, und es ist dieselbe, die auch Batman verspürt.
Auch zeichnerisch ist „Der Gargoyle von Gotham“ auf hohem Niveau. Das Comic-Layout besteht zum großen Teil aus senkrechten und waagerechten Linien zwischen den Panels. Nur wenn es richtig zur Sache geht, rutschen die Linien aus der Symmetrie. Man könnte meinen, der Comic sei zu kontrolliert und wenig wagemutig, wenn er seine Geschichte so stark formgebunden präsentiert. Doch das Gegenteil ist der Fall: Nicht die Form gibt dem Comic seine Geschwindigkeit und seinen Drive, sondern die stimmungsvollen Inhalte der einzelnen Panels, die geradezu filmisch anmuten.
Wer versteht die Hinweise?
Grampá zieht aber noch eine zweite Ebene ein: Für besonders aufmerksame Leser*innen hat er in seinen Panels dezente Hinweise und Botschaften versteckt, etwa eine Hommage an David Fincher und Frank Miller. Wer von uns kratzt beim Lesen nur an der Oberfläche und wer versteht die Anzeichen?
Grampás „Gargoyle von Gotham“ soll nach vier großformatigen Bänden abgeschlossen sein. Der zweite Band erscheint in Deutschland am 20. Februar 2024, die Erscheinungstermine für die beiden letzten Bände sind noch nicht bekannt.
Schon der Auftaktband bringt uns wahren Nervenkitzel, viel Action, aber auch wohldurchdachte leise Szenen; und während wir Batman dabei zusehen, wie er die dunkelsten Ränder seines eigenen Herzens abschreitet, werden wir Zeugen von der wahnsinnigen Kunstfertigkeit des Rafael Grampá. Im Interview mit Popverse erklärt er: „Diese Geschichte ist mein Versuch, Batman zu sezieren, weil ich diesen Charakter liebe und ihn auf den heißen Stuhl setzen wollte.“ Davon wollen wir unbedingt noch mehr! Breite deinen Mantel aus, Batman, und leg los!
Rafael Grampá: Batman – der Gargoyle von Gotham, Panini-Verlag, Stuttgart, 2023, 60 Seiten, gebunden, Euro, ISBN 978-3741635335, Leseprobe;
Rafael Grampá: Batman – der Gargoyle von Gotham (Variant-Cover), Panini-Verlag, Stuttgart, 2023, 60 Seiten, gebunden, 20 Euro, ISBN 978-3741635335, limitiert auf 333 Exemplare.